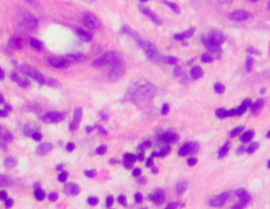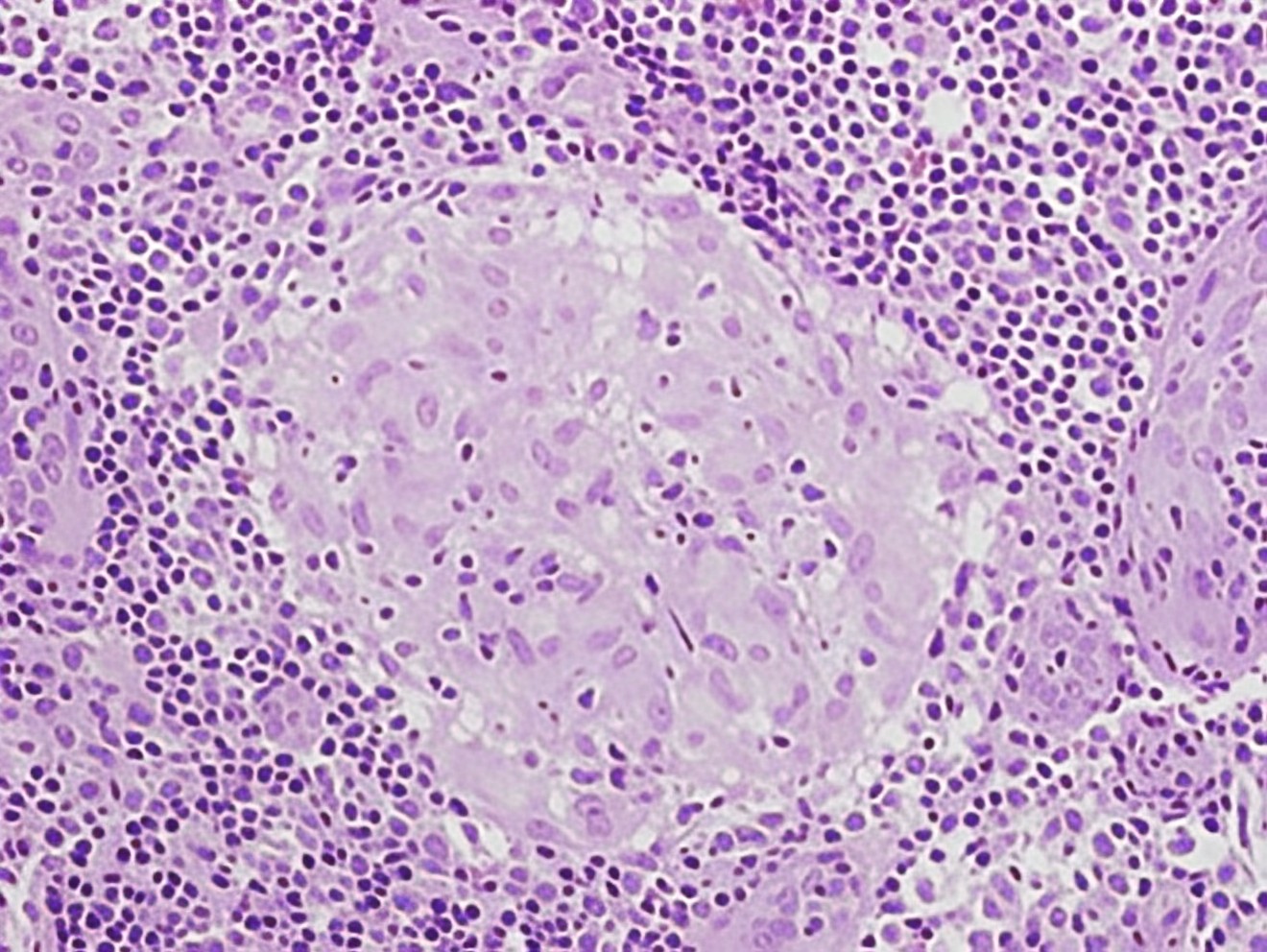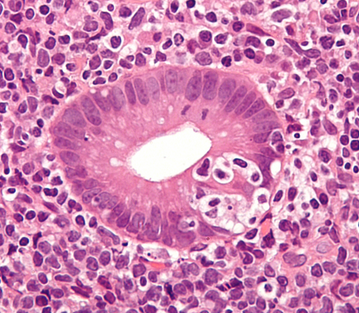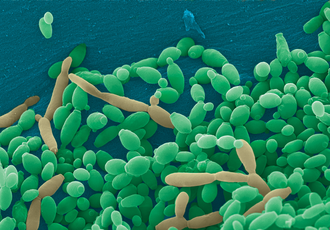|
Giemsa-Färbung
|
Die Giemsa-Färbung ist eine polychrome histologische und zytologische Färbung, die zur Darstellung von Zellkernen, Zytoplasma und Mikroorganismen wie Helicobacter pylori, Parasiten und Blutzellen verwendet wird. Sie eignet sich für Gewebeschnitte und Ausstriche.
Färbeprinzip
- Kombination aus Azurfarbstoffen, Methylenblau und Eosin
- Basische Strukturen (z. B. DNA) binden saure Farbstoffe → blau-violett
- Säurehaltige Strukturen (z. B. Zytoplasma) binden basische Farbstoffe → rosa bis hellblau
Typische Färbemuster
Diagnostische Relevanz
Klinische Anwendungen
- Magen: Nachweis von Helicobacter pylori (zusätzlich zu IHC/PAS)
- Hämatologie: Differentialblutbild, Blastenanalyse
- Infektiologie: Nachweis von Plasmodien, Leishmanien, Trypanosomen
Synonyms -
Giemsa
|
|
Grading
|
Grading bezeichnet in der Pathologie die histologische Einstufung der Bösartigkeit eines Tumors anhand seines Differenzierungsgrades und anderer mikroskopischer Merkmale. Beim Grading werden Tumoren in verschiedene Grade eingeteilt (häufig Grad 1 bis 3 oder 4), wobei niedrige Grade (z. B. Grad 1) auf gut differenzierte, weniger aggressive Tumoren und hohe Grade (z. B. Grad 3 oder 4) auf schlecht differenzierte, aggressivere Tumoren hinweisen. Das Grading dient dazu, das Wachstumspotential und die Prognose des Tumors zu beurteilen und kann die Therapieplanung beeinflussen.
|
|
Granulationsgewebe
|
Granulationsgewebe ist ein provisorisches, hochvaskularisiertes Bindegewebe, das im Rahmen der Wundheilung gebildet wird. Es entsteht in der proliferativen Phase der Heilung und dient als Übergangsstruktur zur Narbenbildung.
Histologische Merkmale
- Fibroblasten: Synthese von Kollagen und extrazellulärer Matrix.
- Kapilläre Neubildung (Angiogenese): Dichtes Netzwerk aus neu gebildeten, oft undichten Kapillaren.
- Entzündungszellen: Makrophagen, Lymphozyten und Plasmazellen zur Wundreinigung und Regulation.
- Ödem: Aufgrund der erhöhten Gefäßpermeabilität.
Funktion
- Bereitet das Gewebe auf die Geweberegeneration oder Narbenbildung vor.
- Fördert die Gefäßneubildung für Nährstoff- und Sauerstoffversorgung.
- Unterstützt die Einwanderung von Epithelzellen zur Wunddeckung.
- Wächst in Nekrosen oder Infarktareale ein und baut diese ab.
Klinische Relevanz
- Physiologische Wundheilung: Abbau und Umwandlung in reifes Bindegewebe.
- Chronische Wunden: Persistierendes Granulationsgewebe bei gestörter Heilung.
- Pathologische Narbenbildung: Überschießende Granulation kann zur Keloidbildung führen.
|
|
Granulom
|
Granulome sind umschriebene Ansammlungen aktivierter Makrophagen (Epitheloidzellen), die im Rahmen einer chronisch-entzündlichen Immunreaktion auftreten. Sie dienen der Abkapselung persistierender Reize wie Erreger, Fremdkörper oder Autoantigene.
Histologie
- Zentrale Epitheloidzellen ± mehrkernige Riesenzellen, umgeben von Lymphozyten.
- Verkäsend (mit zentraler Nekrose) oder nicht-verkäsend, je nach Ursache.
Pathogenese und Zytokinvermittelung
- Auslösung durch persistente Antigene, die eine chronische Aktivierung des Immunsystems bewirken.
- Wichtige Zytokine: IFN-γ (von Th1-Zellen) → aktiviert Makrophagen; TNF-α → unterstützt Granulombildung und Erhaltung; IL-12 → fördert Th1-Antwort.
- Granulombildung ist ein zellulär-immunvermittelter Prozess, dominiert von Makrophagen und T-Helferzellen.
Ursachen (mit Granulomtyp)
- Tuberkulose: verkäsend (Mykobakterien).
- Sarkoidose, Crohn: nicht-verkäsend.
- Fremdkörper: nicht-verkäsend, oft mit Fremdkörper-Riesenzellen.
Diagnostik
Synonyms -
Granulome,granulomatös,granulomatöse
|
|
Grocott-Färbung
|
Die Grocott-Färbung (auch: Grocott-Gomori-Methenamin-Silberfärbung (GMS)) ist eine silberbasierte Spezialfärbung zum Nachweis von pilztypischen Zellwandbestandteilen. Sie ist ein diagnostischer Standard zum histologischen Nachweis von Pilzen im Gewebe.
Färbeprinzip
- Oxidation von Polysacchariden in Pilzwänden zu Aldehyden (Chromogensäure)
- Silberreduktion an Aldehydgruppen durch Methenamin-Silberlösung → schwarzbraune Färbung
- Gegenfärbung z. B. mit Hellgrün oder Kernrot zur besseren Kontrastierung
Typische Färbemuster
- Pilze: Zellwände erscheinen schwarz (z. B. Candida, Aspergillus, Pneumocystis)
- Gewebe: Blassgrün oder rötlich je nach Gegenfärbung
Diagnostische Relevanz
- Zuverlässiger Nachweis von invasiven Mykosen in Biopsien
- Wird häufig bei granulomatösen oder nekrotisierenden Entzündungen eingesetzt
- Essentiell bei immunsupprimierten Patienten mit unklaren Infektionen
Klinische Anwendungen
- Lunge: Nachweis von Pneumocystis-jirovecii-Pneumonie (PJP)
- Haut, ZNS, GIT: Darstellung invasiver Mykosen (z. B. Aspergillose, Histoplasmose)
- Transplantations- und Tumorpatienten: Diagnostik systemischer Pilzinfektionen
Synonyms -
Grocott
|
|
H+/K+-ATPase
|
H+/K+-ATPase
Die H+/K+-ATPase ist eine Protonen-Kalium-Pumpe, die in den Parietalzellen ( Belegzellen) des Magens lokalisiert ist. Sie ist verantwortlich für die aktive Sekretion von Magensäure (HCl) in das Lumen des Magens durch Austausch von intrazellulären H +-Ionen gegen extrazelluläre K +-Ionen unter Verbrauch von ATP.
Funktion
- Schlüsselenzym für die Salzsäureproduktion im Magen
- Aktiv in der Canaliculi-Membran der Parietalzellen
- Reguliert durch Histamin, Gastrin und Acetylcholin
Pathologische Relevanz
- Überaktivität kann zu Hyperazidität, Refluxkrankheit oder peptischen Ulzera führen
- Autoantikörper gegen die H+/K+-ATPase sind typisch für die chronisch atrophische Autoimmungastritis
Therapeutische Relevanz
- Protonenpumpenhemmer (PPI) wie Omeprazol oder Pantoprazol hemmen irreversibel die H+/K+-ATPase und senken effektiv die Magensäureproduktion
Synonyms -
H+/K+-ATPase
|
|
Hämangiose
|
Hämangiose (Blutgefäßinvasion) bezeichnet die intra- oder perivaskuläre Ausbreitung maligner Tumorzellen in Blutgefäßen, meist Kapillaren oder kleinen Venen. Sie ist ein Hinweis auf erhöhte Metastasierungsneigung und zählt im TNM-System als V1/V2-Kriterium.
Pathogenese & molekulare Mechanismen
- Aktive Invasion durch Tumorzellen über proteolytische Enzyme wie Matrix-Metalloproteinasen (MMPs)
- Verlust von Zelladhäsion (z. B. ↓E-Cadherin), ↑Integrine → erleichterte Transmigration durch das Endothel
- Neoangiogenese durch VEGF-A, FGF2, Angiopoietin-2 → begünstigt vaskuläre Invasion
- EpCAM, EMT-induzierende Transkriptionsfaktoren (z. B. Snail, Twist) fördern die Invasivität
Histologie
- Tumorzellnester in Erythrozyten-haltigen Gefäßen mit muskulärer Wand
- CD31, CD34: Marker zur Darstellung vaskulärer Endothelien
- Abgrenzung zur Lymphangiose durch Nachweis von Podoplanin (D2-40) negativ
Klinische Relevanz
- V1/V2-Klassifikation im TNM-System (V1 = mikroskopisch, V2 = makroskopisch)
- Hinweis auf erhöhte Wahrscheinlichkeit für hämatogene Metastasierung (z. B. Leber, Lunge)
- Typisch bei: Kolonkarzinom, Magenkarzinom, Sarkome, Nierenzellkarzinom
Synonyms -
Haemangiose, Hämangiose, Haemangiosis carcinomatosa, V1, V2, Veneninvasios, Venangiosis
|
|
Hämatin
|
Hämatin ist ein dunkelbraunes bis schwarzbraunes Pigment, das durch die Oxidation von Häm entsteht. Es enthält dreiwertiges Eisen (Fe³⁺) und ist vor allem als Abbauprodukt von Blut in saurem Milieu nachweisbar. Hämatin ist chemisch stabil und wasserunlöslich.
Entstehung
- Oxidation von Hämoglobin/Häm bei saurem pH oder unter Sauerstoffeinfluss
- Bildung z. B. bei Magenblutungen (Hämatin im Erbrochenen = „Kaffeesatzerbrechen“)
- Auch als Formalinpigment in schlecht gepufferten Fixierungen sichtbar („Formalin-Hämatin“)
Histologie
- Dunkelbraunes, amorphes Pigment, oft extrazellulär oder in Makrophagen
- Berliner-Blau-negativ (nicht eisenfrei), PAS-negativ, schwach lichtbrechend
- Formalin-Hämatin kann Artefakt darstellen und histologische Beurteilung stören, kann durch Pikrinsäurebehandlung entfernt werden
Klinische Relevanz
Synonyms -
Formalinpigment
|
|
Hämaturie
|
Hämaturie bezeichnet das Vorhandensein von Blut im Urin. Sie wird je nach Sichtbarkeit in zwei Formen unterteilt:
- Makrohämaturie: Sichtbares Blut im Urin, oft rötlich bis braun gefärbt.
- Mikrohämaturie: Nicht sichtbares Blut, das nur mikroskopisch oder durch Tests nachweisbar ist.
Hämaturie kann durch zahlreiche Ursachen bedingt sein, darunter Harnwegsinfektionen, Nierensteine, Tumore (z. B. Blasenkarzinom), Trauma oder Glomerulonephritis. Sie ist ein häufiges Symptom und sollte zur Abklärung der Ursache immer diagnostisch untersucht werden.
|
|
Hämoglobin
|
Hämoglobin (Hb) ist ein eisenhaltiges, sauerstoffbindendes Protein in Erythrozyten. Es ist entscheidend für den Transport von O₂ und CO₂ im Blut und verleiht den Erythrozyten ihre rote Farbe.
Struktur und Funktion
- Besteht aus vier Globinketten (Bei Erwachsenen: 2 α, 2 β) und jeweils einem Häm-Molekül mit zentralem Fe²⁺-Ion
- Bindet reversibel Sauerstoff (O₂) in der Lunge und gibt ihn im Gewebe ab
- Auch Transport von CO₂ und H⁺, puffernde Wirkung im Blut
Laborwert (Blut)
- Normalwerte: Männer: 13,5–17,5 g/dl, Frauen: 12,0–16,0 g/dl
- Erniedrigt: bei Anämie, Blutverlust, Knochenmarkinsuffizienz
- Erhöht: bei Polyglobulie, Hypoxie, Dehydratation
- HbA1c: Glykohämoglobin – spiegelt den mittleren Blutzucker der letzten ~8 Wochen wider; Referenzwert: < 5,7 % (nicht-diabetisch)
Pathologische Aspekte
- Abbau in Milz → Häm → Biliverdin → Bilirubin + Eisen (→ Speicherung als Ferritin/Hämosiderin)
- Bei Hämolyse: freies Hämoglobin im Plasma, ggf. Hämoglobinurie
- Veränderte Formen: z. B. Methämoglobin (Fe³⁺), Carboxyhämoglobin (CO) → Funktionsverlust
- Hämoglobinopathien: Struktur- oder Synthesedefekte der Globinketten, z. B. Sichelzellkrankheit, Thalassämien
|
|
Hämophagozytose
|
Hämophagozytose bezeichnet die aktive Phagozytose reifer Blutzellen und ihrer Vorstufen durch Makrophagen, typischerweise im Knochenmark, Milz oder Leber. Sie stellt ein pathologisches Zeichen einer fehlregulierten Immunaktivierung dar.
Pathophysiologie
- Ausgelöst durch zytotoxische Dysregulation von NK- und T-Zellen mit gesteigerter Zytokinfreisetzung (v. a. IFN-γ, IL-6, TNF-α).
- Folge ist eine Hyperaktivierung von Makrophagen, die neben Erythrozyten auch Leukozyten und Thrombozyten phagozytieren.
- Teil der Pathogenese bei hämophagozytischer Lymphohistiozytose (HLH).
Vorkommen und klinische Relevanz
- HLH (primär oder sekundär): genetisch (z. B. PRF1-Mutationen) oder reaktiv bei Infektionen (v. a. EBV, aber auch CMV, Parvovirus B19), Malignomen, Autoimmunerkrankungen (MAS).
- Schwere Infektionen: z. B. Leishmaniose, Tuberkulose, systemische Mykosen.
- Maligne Erkrankungen: v. a. T-Zell-Lymphome, Leukämien.
Diagnostik
- Nachweis in Knochenmark- oder Milzpräparaten: Makrophagen mit intakten Erythrozyten, Granulozyten, Lymphozyten oder deren Vorläufern im Zytoplasma.
- Begleitende Laborbefunde: Zytopenien, Hyperferritinämie, erhöhte Triglyzeride, Hypofibrinogenämie, ↑ sIL-2R.
- Bestandteil der HLH-Diagnosekriterien (z. B. HLH-2004, HScore).
|
|
Hämosiderin
|
Hämosiderin ist ein intrazelluläres Eisen-Speicherpigment, das beim Abbau von Hämoglobin entsteht. Es liegt als unlöslicher Eisen-Protein-Komplex vor und ist ein Marker für Eisenüberladung und Hämoglobin-Abbau in Geweben.
Entstehung
- Abbau von Hämoglobin in Makrophagen → Häm-Abspaltung und Hämoxygenase-vermittelter Häm-Abbau mit Eisenfreisetzung
- Freisetzung von Eisen → intrazelluläre Speicherung als Hämosiderin (nicht löslich wie Ferritin)
- Auftreten bei Hämatomen, chronischer Stauung, Hämolyse oder transfusionsbedingter Eisenüberladung
Histologie und Nachweis
- Grobkörnige, goldbraune Granula im Zytoplasma (v. a. in Makrophagen)
- Berliner-Blau-Reaktion: Histochemische Eisenfärbung – Eisen(III) reagiert mit Kaliumhexacyanoferrat zu Preußisch Blau
- Typische Organe: Leber, Milz, Lunge, Knochenmark
Klinische Relevanz
- Hämosiderose: Eisenablagerung ohne Organschädigung (z. B. nach Transfusionen)
- Hämochromatose: Genetisch bedingte Eisenüberladung mit Organschäden
- Stauungslunge: Herzfehlerzellen (Makrophagen mit Hämosiderin) als Hinweis auf chronische Linksherzinsuffizienz
|
|
Hauttypen nach Fitzpatrick
|
Die Hauttypen nach Fitzpatrick werden zur Einschätzung der Hautreaktion auf UV-Strahlung verwendet. Sie dienen insbesondere der Beurteilung des Hautkrebsrisikos und der Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen.
| Hauttyp | Merkmale | Reaktion auf UV-Strahlung |
|---|
| Typ I |
Sehr helle Haut, oft mit Sommersprossen, rote oder blonde Haare |
Immer Sonnenbrand, keine Bräunung |
| Typ II |
Helle Haut, blonde oder hellbraune Haare |
Häufig Sonnenbrand, minimale Bräunung |
| Typ III |
Helle bis leicht gebräunte Haut, dunkelblonde oder braune Haare |
Manchmal Sonnenbrand, gleichmäßige Bräunung |
| Typ IV |
Hellbraune oder olivfarbene Haut, braune oder schwarze Haare |
Selten Sonnenbrand, gute Bräunung |
| Typ V |
Dunkelbraune Haut, schwarze Haare |
Sehr selten Sonnenbrand, sehr gute Bräunung |
| Typ VI |
Sehr dunkle bis schwarze Haut |
Nie Sonnenbrand, keine sichtbare Bräunung |
Synonyms -
Fitzpatrick
|
|
HE
|
Hämatoxylin-Eosin (HE) ist die am häufigsten verwendete Routinefärbung in der Histopathologie. Sie dient der Kontrastierung zellulärer und geweblicher Strukturen und ist die Basis für die lichtmikroskopische Diagnostik.
Färbeprinzip
- Hämatoxylin: Basischer Farbstoff, färbt DNA-haltige Strukturen (Zellkerne, Ribosomen) blauviolett
- Eosin: Saurer Farbstoff, färbt proteinhaltige Strukturen (Zytoplasma, Kollagen) rosa bis rot
- Kontrastfärbung ermöglicht die morphologische Beurteilung von Geweben und Zellen
Typische Färbemuster
- Zellkerne: Dunkelblau bis violett (Hämatoxylin-positiv)
- Zytoplasma: Hellrosa bis rot (Eosin-positiv)
- Kollagenfasern: Blassrosa
- Erythrozyten: Leuchtend orange-rot
Diagnostische Relevanz
- Ermöglicht Beurteilung von Gewebearchitektur und Zellmorphologie
- Identifikation von entzündlichen, degenerativen und neoplastischen Veränderungen
- Grundlage vor Spezialfärbungen oder Immunhistochemie (IHC)
Klinische Anwendungen
- Tumordiagnostik: Beurteilung von Dignität, Differenzierung und Invasion
- Entzündliche Erkrankungen: Charakterisierung von Infiltraten und Gewebereaktionen
- Gewebenekrosen: Erfassung ischämischer oder toxischer Schäden
Synonyms -
Hämatoxylin-Eosin-Färbung,HE-Färbung
|
|
Hefen
|
Hefen sind eukaryotische, einzellige Pilze, die sich typischerweise durch Sprossung vermehren. In der Medizin spielen sie eine wichtige Rolle als opportunistische Krankheitserreger, insbesondere bei immungeschwächten Patienten.
Biologische Merkmale
- Runde bis ovale Einzelzellen mit Zellwand aus Chitin und Glucan.
- Vermehrung durch Sprossung (asexuell), teils auch Bildung von Pseudohyphen.
- Kolonien ähneln bakteriellen auf Agar, oft weiß-cremig.
Medizinisch relevante Hefen
- Candida albicans: häufigster humanpathogener Hefepilz; Erreger von Mukokutanmykosen und systemischer Candidiasis.
- Candida glabrata, C. tropicalis, C. krusei: zunehmend relevant bei nosokomialen Infektionen, oft multiresistent.
- Cryptococcus neoformans: bekapselte Hefe, v. a. bei AIDS; verursacht Meningitis und pulmonale Infektionen.
Klinische Relevanz
- Häufige Erreger bei Immunsuppression, Antibiotikatherapie oder Intensivmedizin.
- Infektionen reichen von oberflächlich (Soor, Vulvovaginitis) bis invasiv (Candidämie, Endokarditis).
Diagnostik
- Direktnachweis im Nativpräparat oder histologisch (z. B. PAS, Grocott).
- Kultur auf Sabouraud-Agar, ggf. MALDI-TOF oder molekulare Typisierung.
Synonyms -
Hefe
|