|
|
|
| Last Update: 18.03.2025 | |
\C-Gastritis\Mikroskopie/C-Gastritis_CCSA40.jpg) |
|
| Kategorie: | Chronische Gastritis |
| ICD-10: | K29.6 (Sonstige Gastritis, chronisch) |
C-Gastritis
Allgemeines:
- Die Typ-C-Gastritis (chemisch-toxische Gastritis) ist eine Form der chronischen Gastritis, die durch eine exogene Noxe verursacht wird.
- Häufige Auslöser sind NSAR, Gallereflux (nach Billroth-II-Operationen oder pyloruserhaltender Resektion) und Alkohol.
- Die Erkrankung ist nicht immunologisch bedingt, sondern Folge einer direkten Schleimhautschädigung.
Klinik:
- Symptome:
- Oberbauchbeschwerden, Druckgefühl, Übelkeit, Völlegefühl.
- In schweren Fällen Erbrechen oder Meläna bei Erosionen.
- Häufig asymptomatisch und nur endoskopisch auffällig.
- Diagnostik:
- Endoskopie: Rötung, Erosionen, ggf. Blutbeimengung, besonders im Antrum.
- Biopsie: Histologischer Nachweis der charakteristischen Veränderungen.
- Anamnese: Einnahme von NSAR, ASS, Gallereflux bekannt, OP-Vorgeschichte.
- Therapie:
- Absetzen oder Umstellung der auslösenden Substanz: z. B. NSAR-Absetzen, Magenschutz bei notwendiger Einnahme.
- Protonenpumpeninhibitoren (PPI): Zur Förderung der Schleimhautregeneration.
- Chirurgische Revision: Bei ausgeprägtem Gallereflux postoperativ.
- Prognose:
Epidemiologie:
- Häufigste Form der Gastritis nach Typ-B-Gastritis (H. pylori).
- Erhöhtes Risiko bei chronischer NSAR-Einnahme, älteren Patienten und operierten Magenanatomien.
- Erhebliche Dunkelziffer, da oft klinisch stumm.
Pathogenese:
- Direkte toxische Wirkung von Substanzen wie Gallensäuren, NSAR oder Ethanol auf das Magenepithel.
- Störung der mukosalen Barriere (Muzinschicht und tight junctions).
- NSAR-vermittelt:
- Hemmung der Cyclooxygenase-1 ( COX-1 ) führt zu verminderter Prostaglandinsynthese (v. a. PGE2).
- Reduktion von Prostaglandin E2 resultiert in: ↓ Schleimproduktion, ↓ Bikarbonatsekretion, ↓ Mukosadurchblutung, ↑ Säureexposition.
- Zusätzliche direkte Epithelschädigung durch lipophile NSAR.
- Gallereflux-vermittelt:
- Gallensäuren wirken zytotoxisch auf das Oberflächenepithel und lösen Entzündungsprozesse aus.
- Hydrophobe Gallensalze destabilisieren die Lipidmembran, erhöhen die intrazelluläre Kalziumkonzentration und führen zur Mitochondrienschädigung.
- Aktivierung von NF-κB und Freisetzung proinflammatorischer Zytokine (z. B. IL-8, TNF-α).
- Molekulare Marker und Signalwege:
- Erhöhte Expression von COX-2 bei chronischer Exposition, teils als adaptive Antwort.
- Induktion oxidativer Stress-Signalwege (z. B. Nrf2/ARE-Pfad).
- DNA-Schädigung durch ROS (reaktive Sauerstoffspezies), mögliche präneoplastische Entwicklung bei chronischer Irritation.
Makroskopie:
- Hyperämie und fleckige Erosionen, bevorzugt im Antrum und Korpus.
- Schleimhaut fragil, punktförmige Blutungen möglich.
- Bei chronischer Schädigung: Mucosa-Atrophie und Rötung.
Mikroskopie:
- Foveoläre Hyperplasie („Korkenziehermuster“ der Oberfläche).
- Ödem, Kapillardilatation und geringe Entzündung (meist lymphozytär, wenige neutrophile Granulozyten).
- Erosionen mit Fibrinauflagerung möglich.
- Selten regenerative Atypien.
\C-Gastritis\Mikroskopie/C-Gastritis_CCSA40.jpg)
Antrumschleimhaut mit foveolärer Hyperplasie, geringer chronischer Entzündung und glattmuskulären Proliferaten
Differentialdiagnosen:
- Typ-B-Gastritis (H. pylori):
- Dichte Entzündung mit Neutrophilen, Lymphfollikelbildung, Nachweis von H. pylori.
- Typ-A-Gastritis:
- Bevorzugt im Korpus, assoziiert mit Autoimmungastritis, Parietalzellverlust und intestinaler Metaplasie.
- Reaktive Veränderungen nach Gastrin-Überstimulation (z. B. Zollinger-Ellison):
- Foveoläre Hyperplasie ohne Erosionen; klinischer Kontext entscheidend.
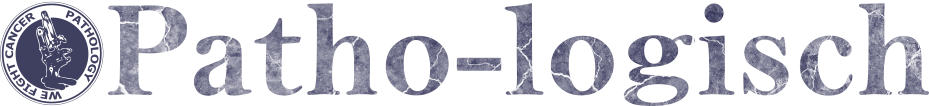
 Patienteninformation
Patienteninformation Anmerkung zu Gesundheitsthemen
Anmerkung zu Gesundheitsthemen